Im Puff drängeln
Born To Be Wild – Steppenwolf (Live/1970)
Sorry, ich hatte das Ganze irgendwie komplett verdrängt und muss nun wohl leider zugeben, dass eine der wohl abgedroschensten Nummern der gesamten Rockgeschichte bei mir immer noch Gänsehaut erzeugt, wenn ich sie einmal zufällig im Radio höre.
Yeah, darlin‘, gonna make it happen
Take the world in a love embrace
Fire all of your guns at once
And explode into space
Zufällig heißt in diesem Fall, dass ich mich irgendwo außerhalb des Großraums Berlin auf der Autobahn befinde und hektisch am Sendersuchlauf des Radios hantiere, um halbwegs brauchbare Musik zu empfangen. Doch es gibt außerhalb Berlins einfach keine brauchbaren Sender und ich komme mir auf der Fahrt schon nach ein paar Minuten vor wie zu der Zeit, als ich als Dreikäsehoch das große Radio in der Küche meiner Eltern für mich entdeckt hatte. Was für eine Zeitreise, dabei hatte ich gerade eben erst die Landesgrenze von Sachsen/Anhalt passiert. Und auch wenn die Songs natürlich nicht dieselben waren, so gibt es zwischen der Elbe und dem Allgäu, zwischen Flensburg und Freiburg stets einen Strauß bunter Melodien aus dem reichhaltigen deutschen Schlagerfundus oder aber, wenn es einmal richtig innovativ und fortschrittlich sein soll, das Beste aus den 70ern, 80ern und 90ern zu hören, also die üblichen Verdächtigen wie ABBA, Phil Collins und Boney M.
Doch dann plötzlich, kurz vor der Landesgrenze nach Thüringen, empfange ich einen rauschenden Oldie-Sender, der mein Herz bei der steten Wahl zwischen Pest und Cholera merklich höherschlagen lässt. Ich will es mit der Euphorie nicht gleich übertreiben, denn der Moderator, hörbar kurz vor dem Vorruhestand, würde auf diesem Sender selbst mit dem Abspielen von gut abgehangenen alten Schinken der Marke Pearl Jam oder Rage Against The Machine schon vor der fristlosen Kündigung stehen, aber immerhin. Es läuft: „Born To Be Wild!“
Klar hat dieser Song natürlich schon erheblich Patina angesetzt und niemand denkt beim Hören mehr an wilde Rocker, die mit ihren laut dröhnenden Maschinen ganze Völkerstämme in Angst und Schrecken versetzen können, sondern man denkt wohl eher an rüstige Rentner, die sich von ihrer ausgezahlten Lebensversicherung nun endlich ihre Harley Davidson leisten können, um damit urgemütlich auf den Landstraßen umherzutuckern, um den Fahrern der japanischen Joghurtbecher im Weg zu stehen. Aber wie auch immer: Lieber eine Harley unter dem Arsch, als im Prenzlauer Berg mit einem Kopfkissen unter den verschränkten Armen gelangweilt die Passanten auf der Straße zu beobachten, immer in der Hoffnung, dass heute noch irgendetwas passiert. Doch es passiert leider nichts mehr – und schon gar nicht im durchsanierten Prenzlauer Berg, in dem man sich selbst als reicher Rentner heutzutage nur eine Harley oder eine Wohnung leisten kann. Die Betonung liegt auf „oder“.
„Born To Be Wild“ also, wobei mir gerade eines auffällt: Der ewige Sommer! Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Warum in Drei Gottes Namen scheint in diesen alten Roadmovies eigentlich stets und ständig die Sonne? Meine erste Fahrstunde auf dem Motorrad habe ich im strömenden Regen absolviert und auf jeder längeren Tour – und das meine ich wirklich wörtlich – pisst es mindestens 3 Tage lang wie aus Kübeln. Aber in Gottes eigenem Land? In Harley-USA? Wo immer man hinschaut nichts als eitel Sonnenschein. Selbst in der berühmten Szene in „Easy Rider“, immerhin der Film, welcher „Born To Be Wild“ damals weltbekannt gemacht hat, scheint selbst in dem Moment die Sonne, als die beiden Hauptakteure vom Motorrad geschossen werden. Fuck, das war traurig! Sonnenschein? Ein bisschen Blitz und Donner sowie der eine oder andere Regenschauer hätten dieser Szene vielleicht etwas mehr Gesicht verliehen. Aber das ist jetzt auch Geschichte.
Doch zurück zum Song. Warum klebt man manchmal an bestimmten Liedern wie die Fliege am Klebeband? Ich versuche es mir in diesem Fall so zu erklären: Als kleiner Knirps bekam ich mit 9 Jahren eine feuerrote Bassgitarre zum Geburtstag und mein Vater meldete mich kurzerhand auf der Musikschule an, damit er mein Geklimpere zu Hause – auf seiner eigenen feuerroten E-Gitarre – unter Aufsicht in geordnete Bahnen lenken konnte. Doch der Gitarrenunterricht war voll, also wählte ich dann eben Bass, was mir völlig egal war, denn das einzige Kriterium für mich war, dass mein Instrument elektrisch sein musste, genau wie das Instrument meines Vaters. Und so lernte ich fortan Noten und spielte, mangels Rock-Literatur, stundenlang Fingerübungen und klassische Etüden. Die erste musikalische Krise ließ dann auch nicht lange auf sich warten, denn meine Großeltern forderten ein Jahr später, es war Weihnachten, eine Probe meines Könnens in Form eines Weihnachtsliedes.
„Irgendein Weihnachtslied wirst du uns doch wohl vorspielen können, oder?“, lachten sie, doch ich hatte schon verloren.
Ich konnte Gedichte aufsagen, sogar die meines Bruders, der sich immer pünktlich zur Bescherung aus dem Staub machte, um nicht in die Verlegenheit des Rezitierens zu kommen. Aber Weihnachtslieder auf einer Bassgitarre? Wie sollte das gehen? Mein Lehrer brauchte mehrere Stunden, um mich wieder aufzurichten, ein gemütlicher Sachse, der in einer bekannten Band spielte und meine Sorgen verstand. Er lud mich wenig später zu sich nach Hause ein und zeigte mir seine riesige Schallplattensammlung – und wenn ich sage riesig, dann meine ich das auch so. Dort standen sämtliche Originalalben der Beatles einträchtig neben der Gesamtausgabe von Pink Floyd, CCR und den Rolling Stones und der Anblick dieser Schätze ließ mich erblassen. Ich wusste noch nicht viel von Musik, aber ich bekam eine Ahnung davon, wie es einem Forscher ergehen muss, der vielleicht eines Tages das Bernsteinzimmer in irgendeinem Stollen im Erzgebirge entdeckt. Dann zog mein Lehrer eine Platte von The Who aus dem Schrank, lenkte vorsichtig die Nadel auf „My Generation“ und spielte einfach mit. John Entwistles kurzes und verrücktes Basssolo ließ meinen Atem stocken, doch er schrieb in wenigen Minuten die Noten eigenhändig in mein Notenheft und ließ mich das Stück dann selbst probieren. Ich war natürlich meilenweit vom Originaltempo entfernt, doch nun wusste ich, warum der Bass ein so geiles Instrument ist. Stolz ging ich nach Hause und übte in den nächsten Wochen nichts anderes.
„Bring einfach ein paar Kassetten mit, dann überspiele ich dir, was dich interessiert.“, gab er mir mit auf den Weg und fortan setzte ich sämtliches Westgeld von meinem Opa im Intershop in BASF-Kassetten um. Als erstes bat ich meinen Lehrer um eines seiner Lieblingsalben und ich bekam das Live-Doppelalbum von Steppenwolf überspielt. Ich kannte die Band überhaupt nicht, doch beim Anblick des Covers – und vor allem beim Namen des Bandleaders John Kay – musste auch die Musik gut sein. Stolz schob ich zu Hause die Kassette in den Rekorder und dann hat es mich einfach umgeblasen: „Born To Be Wild!“
Get your motor runnin‘
Head out on the highway
Looking for adventure
In whatever comes our way
Drei Jahre später, ich war gerade 14 geworden, war es jedoch gerade dieser Song, der mein persönliches Waterloo bedeuten sollte. Eine Schülerband suchte einen Bassisten, doch leider waren die Musiker alle schon etwas älter und bereits auf dem Gymnasium, so dass sich ihre Gespräche schon um ganz andere Dinge drehten, die ich nur mit Staunen verfolgte, während ich so tat, als wäre es bei mir an der Tagesordnung, dass ich Zigaretten und ein Bier in meiner Tasche hatte. Doch meine Eltern gaben meinem Drängen schließlich nach und erlaubten mir mit der Band zu proben. Doch es kam, wie es kommen musste, denn wenige Proben später stand „Born To Be Wild“ auf dem Programm, während ich bisher immer nur nach Noten gespielt und vom freien Improvisieren nicht die geringste Ahnung hatte.
„Na, du spielst einfach das Riff auf E, so wie ich spiele!“, maulte der Gitarrist ungeduldig, während ich merkte, wie mir meine Felle davonschwammen.
Ich wusste zwar wo E liegt – ich wusste sogar wo alle E’s auf meinem Griffbrett lagen – doch was ich jetzt ohne Noten spielen sollte, das war mir einfach schleierhaft. Ich dudelte also, sehr zum Ärger unseres Gitarristen, irgendwie sinnlos auf der tiefen E-Saite herum und versuchte gute Miene zum bösen Spiel zu machen, bis dann plötzlich der alte Bassist wie zufällig in der Tür stand, sich meinen Bass schnappte, mir das Riff kurz vorspielte, nur um anschließend zu entscheiden, dass er die Band nun doch nicht verlassen würde.
Was für ein Arschloch! Ich konnte eindeutig erkennen, dass seine Handhaltung eine Katastrophe war und dass der Typ mit seinen Gurkenfingern nicht halb so schnell spielen konnte wie ich – und schon gar nicht die Brandenburgischen Konzerte von Johann Sebastian Bach, die ich sogar auswendig konnte – aber meine kurze Karriere war an dieser Stelle wohl beendet! Was wollte ich hier mit den Brandenburgischen Konzerten, wenn es um „Born To Be Wild“ ging? Ich war wohl noch viel zu jung, um das Ganze auch nur ansatzweise verstehen zu können. Und wie sagte man in Berlin so schön? Keine Haare am Sack, aber im Puff drängeln!
Na gut, ich hatte verloren, aber wisst ihr was? Der geilste Song auf diesem Album war sowieso „Monster“, eine ellenlange Nummer mit 48 Abschlägen in der Mitte. 48! Das war so lang, dass mein Lehrer das Stück auf meiner Kassette aus Seite 1 ausgeblendet und auf Seite 2 wieder eingeblendet hatte. So wurden es bei mir am Ende sogar 54 Abschläge! Und wenn ich eines schönen Tages mit meinem Namensvetter John Kay dieses Stück einmal zusammen spielen darf, dann bestehe ich auf genau diese 54 Abschläge. Ich will ja nicht umsonst gedrängelt haben!

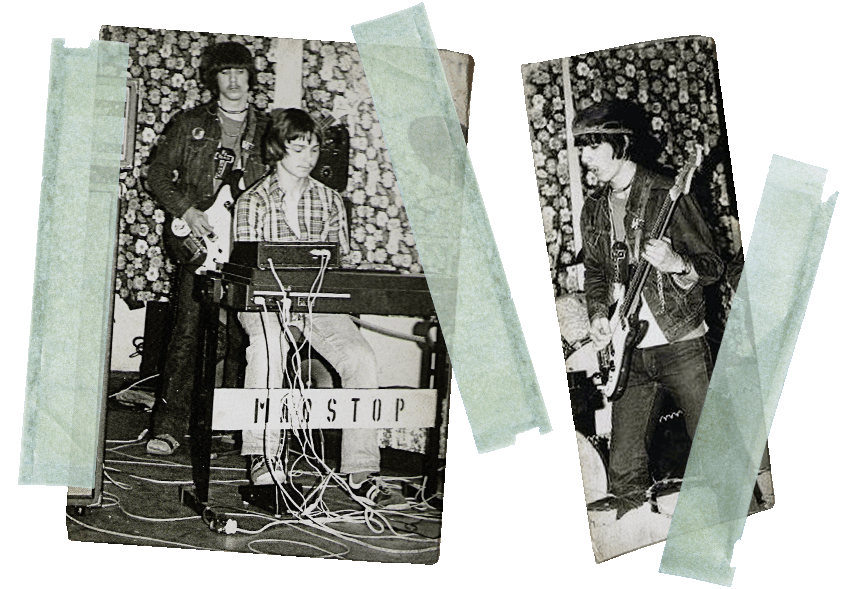
Einfach Super Kay …54 ;-)), bis bald zur Lesung.
Marco